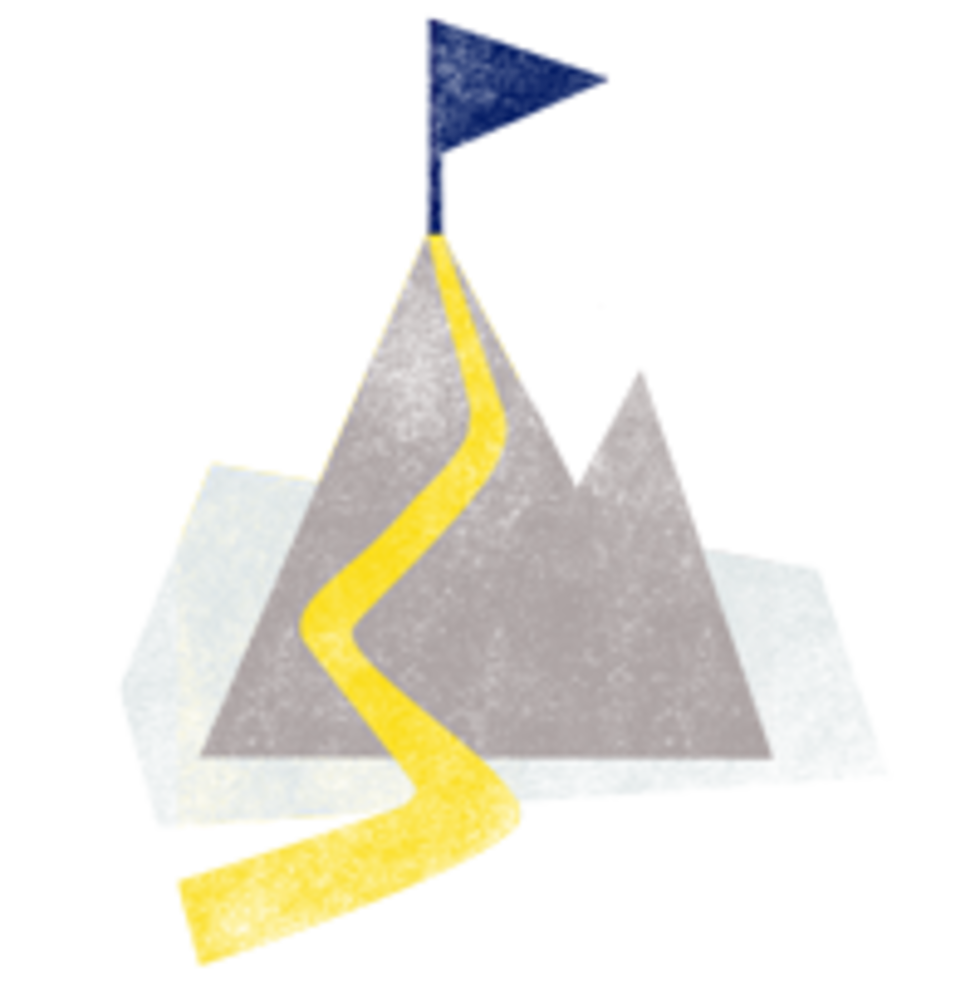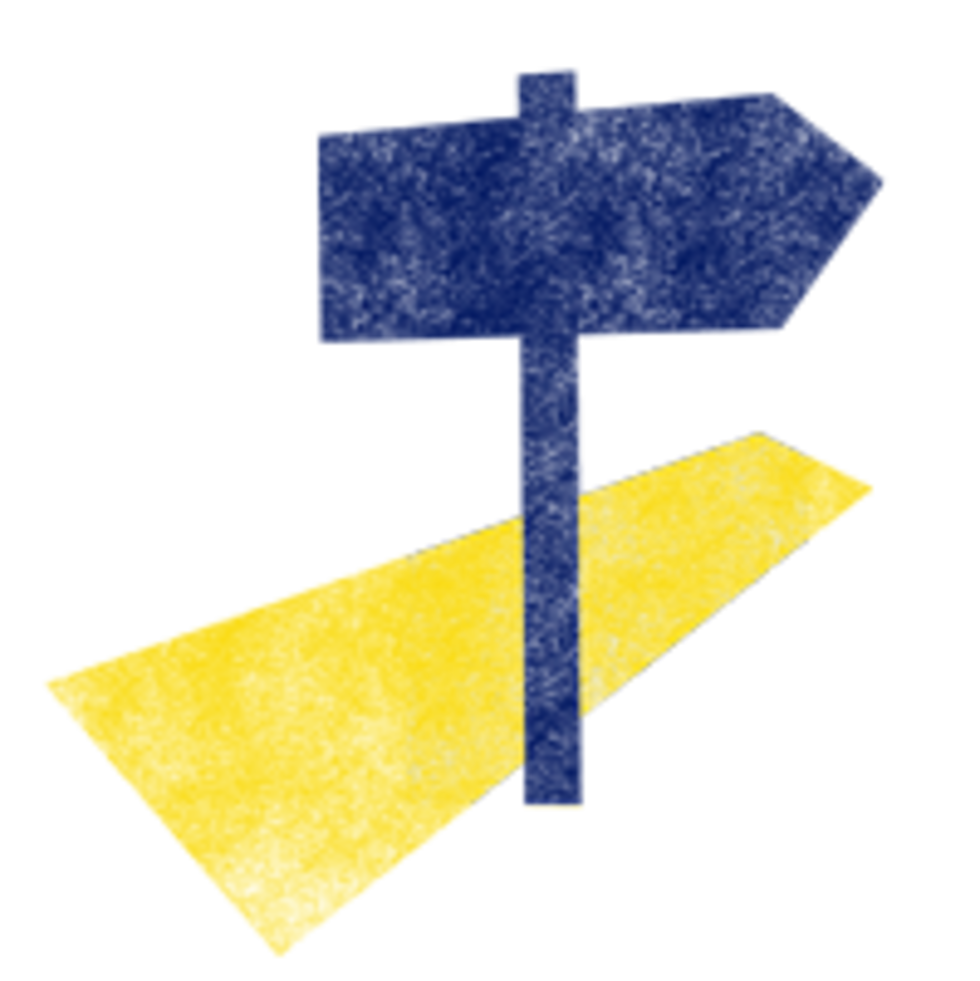
Interkommunale Kooperation in der Raumentwicklung und Raumordnung weiter ausbauen
Handlungsauftrag 4.1.a:
Die zunehmende Komplexität der Aufgaben und die Geschwindigkeit von Veränderungsprozessen sind eine große Herausforderung für alle. Gemeinden und Kleinstädte brauchen einander, damit sie die zukünftigen Herausforderungen besser meistern können. Das erfordert Öffnung und eine Abkehr vom „Kirchturmdenken“ sowie die Bereitschaft, sich auf neue Formen der Koordination und Zusammenarbeit einzulassen.
Mögliche ÖROK-Arbeitsformate und Maßnahmen:
- Die (stadt-)regionale Handlungsebene stärken und die Weiterentwicklung von Formen der interkommunalen Zusammenarbeit unterstützen.
- Effiziente und effektive Kooperationsformate zur Vermeidung von organisatorischen Redundanzen und zur bestmöglichen inhaltlichen Abstimmung über alle Ebenen weiterentwickeln.
Raumtypen
kleinere Stadtregionen mit ihren ländlichen Verdichtungsräumen, ländliche Tourismusregionen, ländliche Räume mit geringer Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsrückgang
Relevante Systeme von Akteur:innen
Länder, Städte, Gemeinden, Städtebund, Gemeindebund
Instrumente
Raumordnungsgesetze, Raumordnungsprogramme, Bedarfszuweisungen für die Gemeinden, Förderungen, Regionalverbände, interkommunale Entwicklungsgesellschaften, Verträge, interkommunaler Finanzausgleich, Modellregionsprogramme, (stadt-)regionale Handlungsebene
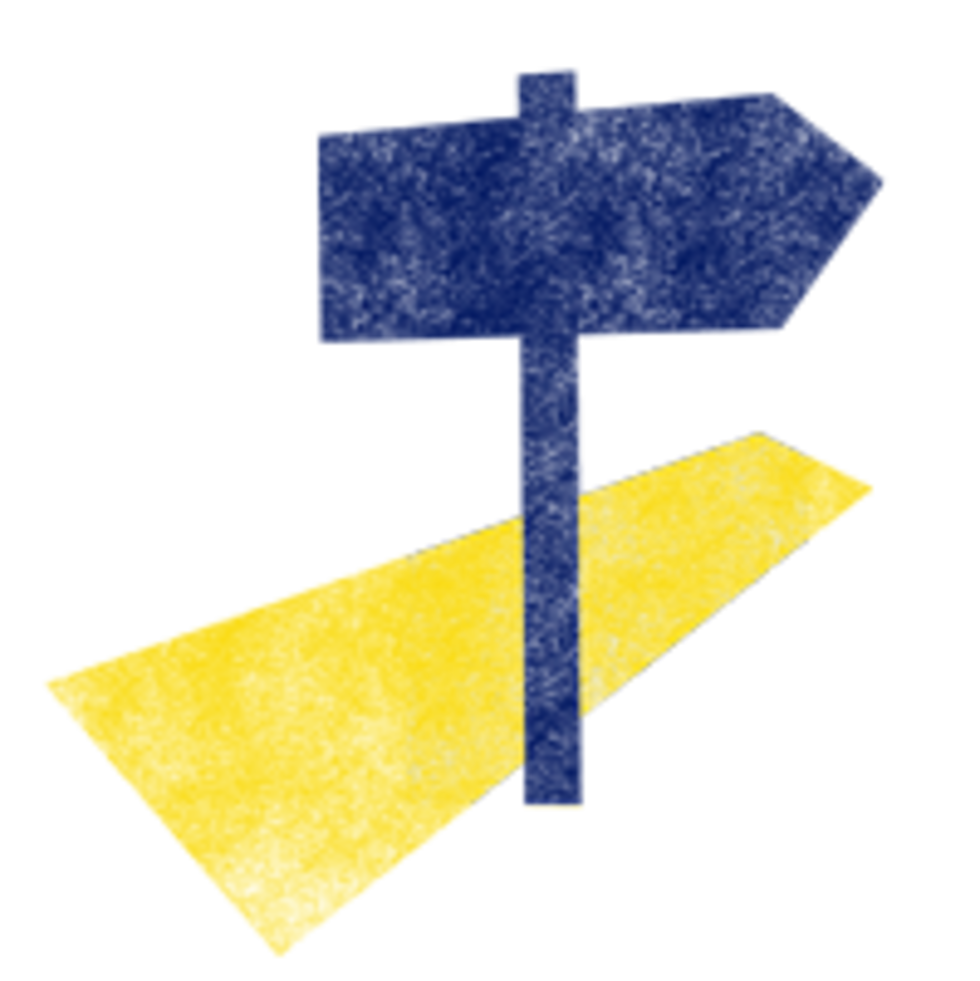
Die (stadt-)regionale Handlungsebene durch eine bessere österreichweite Vernetzung stärken
Handlungsauftrag 4.1.b:
Die (stadt-)regionale Handlungsebene ist für viele Fragen der Raumentwicklung und Raumordnung sowie der integrierten Regionalentwicklung hochrelevant. Sie ist jedoch rechtlich und institutionell nur schwach verankert. Das ist einerseits eine Schwäche, andererseits aber auch eine Chance, weil Gestaltungsräume für innovative Governanceansätze genutzt werden können.
Mögliche ÖROK-Arbeitsformate und Maßnahmen:
- Die (stadt-)regionale Handlungsebene mit dem Auftrag zur Durchführung von österreichweiten Diskursformaten mit einem Fokus auf Schlüsselthemen des ÖREK 2030 stärken.
- Österreichweite Diskursformate zu ausgewählten räumlich relevanten Themen finanzieren.
- Den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer auf der (stadt-)regionalen Handlungsebene stärken.
- Geeignete Voraussetzungen für eine umsetzungsorientierte Aufbereitung und Nutzbarmachung von planungs- und praxisrelevantem Klima-Wissen für Akteur:innen der Raumentwicklung und Raumordnung schaffen.
- Spezifische Entscheidungs-, Arbeits-, Vollzugs- und Praxishilfen (Leitlinien, Handbücher, Prüfkriterien, Checklisten, gute Praxisbeispiele etc.) zur gezielten Berücksichtigung des Klimawandels in der Raumentwicklung und Raumordnung bedarfsorientiert erstellen.
- Vermittlung und Kommunikation an die Akteur:innen der Raumentwicklung aller Planungsebenen (Informationsveranstaltungen, Beratungs- und Schulungsangebote, Aus- und Weiterbildung) unterstützen.
- Vorschläge ausarbeiten, wie die Wirksamkeit der (stadt-)regionalen Handlungsebene verbessert werden kann.
Raumtypen
alle Raumtypen mit raumtypenspezifischer Differenzierung
Relevante Systeme von Akteur:innen
Bund, Länder, Regionen, Städte, Gemeinden, Städtebund, Gemeindebund, ÖROK, Regionalmanagements
Instrumente
(stadt-)regionale Handlungsebene, Finanzierung von regelmäßigen Diskursformaten
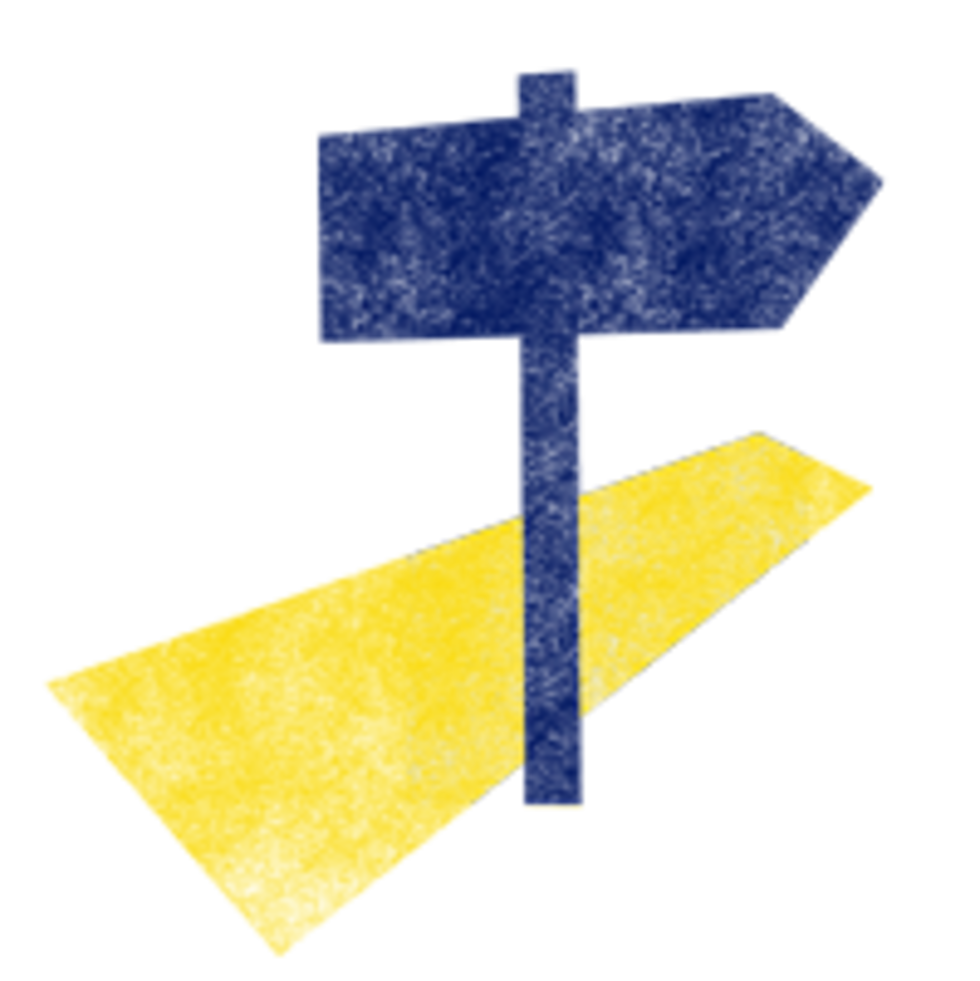
Die (stadt-)regionalen Potenziale für die Umsetzung von Bundes- und Sektorpolitiken besser nutzen
Handlungsauftrag 4.1.c:
Stadtregionen und andere Regionen leisten im Zusammenwirken mit den Bundesländern wesentliche Beiträge zur Umsetzung von raumwirksamen Bundes- und Sektorpolitiken. Dieses Potenzial gilt es weiter im Rahmen der bestehenden Kompetenzen zu entwickeln. Im Sinne einer gesamtstaatlich wirkungsvollen Raumentwicklung, insbesondere für besonders raumrelevante Themen (z.B. Klimawandelanpassung, Mobilität, Energie), gilt dafür eine effektivere Nutzung. Damit die regionale Ebene im Bereich raumwirksamer Politikbereiche des Bundes stärker als bisher wirksam werden kann, braucht es eine intensivere Einbeziehung und Mitsprache sowie eine bessere institutionelle Verankerung und Ressourcenausstattung für die (Stadt-)Regionen. Für eine allfällig erforderliche institutionelle Verankerung und Ressourcenausstattung ist die wechselseitige Abstimmung zwischen dem Bund und den für die Raumordnung zuständigen Bundesländern eine wesentliche Voraussetzung.
Mögliche ÖROK-Arbeitsformate und Maßnahmen:
- Raumwirksame Bundes- und Sektorthemen identifizieren, für deren Umsetzung die (stadt-)regionale Handlungsebene im Rahmen der bestehenden Kompetenzen einen Beitrag leisten kann.
- Die (stadt-)regionale Handlungsebene bei der Programmierung von EU- und Bundesförderprogrammen sowie bei anderen Raumordnungs- und Raumentwicklungsfragen auf Bundesebene einbeziehen.
- Pilotprojekte für eine themen- und raumtypenspezifische Umsetzung durchführen.
- Modellregionen für eine themen- und raumtypenspezifische Umsetzung, z.B. zu Beiträgen der Raumordnung zur Klimaneutralität und -resilienz in Abstimmung mit den Ländern und eingebettet in bestehende rechtliche und organisatorische Strukturen auf der (stadt-)regionalen Ebene prüfen.
- Raumentwicklungsaspekte in bestehenden Fördermodellregionen (KLAR!, KEM) bzw. in LEADER-Strategien in Abstimmung mit den Ländern berücksichtigen.
- Neue Aktivitätsfelder in der Gemeindeberatung (z.B. regionale Klimawandel-Transformations-Manager:innen) etablieren und bereits bestehende intermediäre, regions- und gemeindenah agierende Beratungs- und Transferorganisationen (z.B. Klimabündnis, e5) unter gezielter Vernetzung mit bereits etablierten, regionalen Entwicklungsorganisationen der Länder (z.B. Regionalmanagements) stärken.
- Regionale finanzielle Ausgleichsmechanismen weiterentwickeln.
Raumtypen
alle Raumtypen mit einer raumtypenspezifischen Differenzierung
Relevante Systeme von Akteur:innen
Bund, Länder, Regionen, Städte, Gemeinden, Städtebund, Gemeindebund, ÖROK
Instrumente
Finanzausgleich, regionale Organisationsformate, Plattformformate für die (stadt-) regionale Handlungsebene, Modellregionen, Pilotprojekte, Förderprogramme
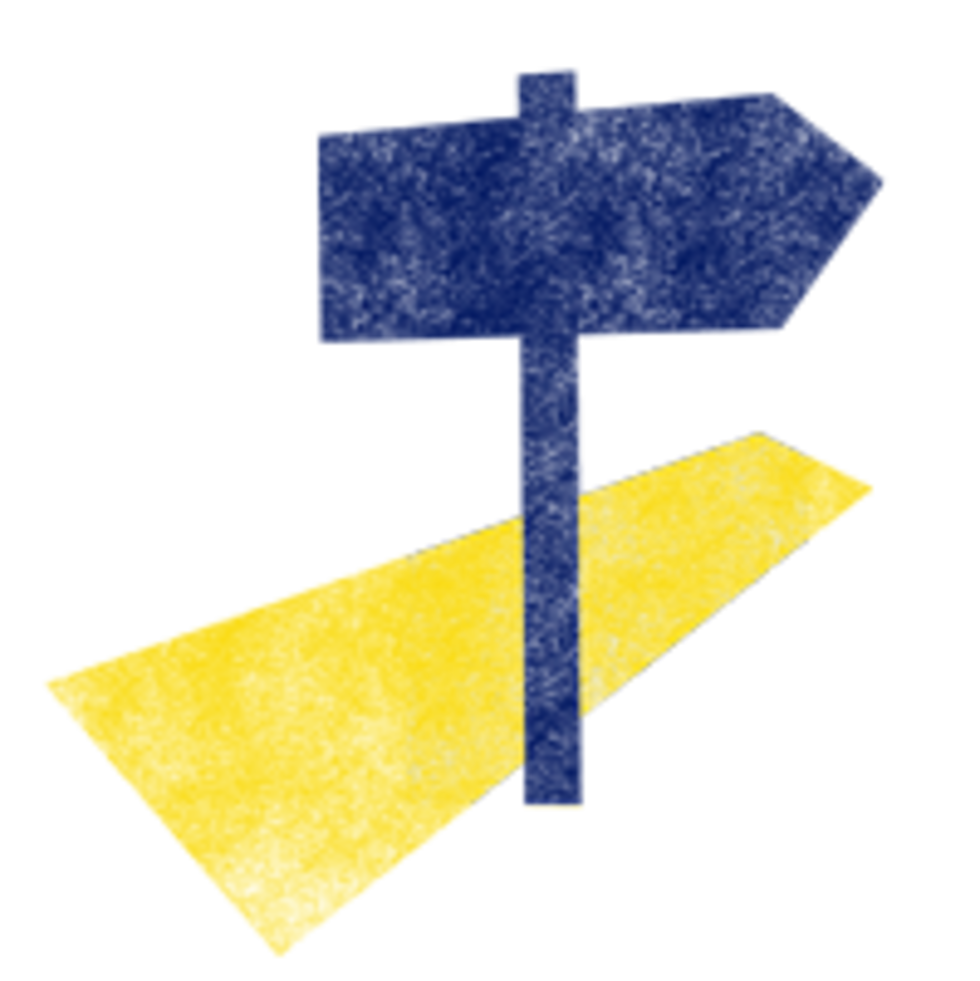
Eine österreichische Stadtregionspolitik in die Umsetzung bringen
Handlungsauftrag 4.1.d:
Städte und Stadtregionen sind wesentliche Akteure der österreichischen Raumordnung und Raumentwicklung. Sie sind Kristallisationspunkte für aktuelle Transformationsprozesse wie Digitalisierung, Migration und gesellschaftliche Vielfalt, Klimakrise und Dekarbonisierung, Bodensparen und Mobilitätswende. Städte und Stadtregionen stehen hier einerseits vor großen Herausforderungen. Sie besitzen andererseits auch große Problemlösungskapazitäten und können das auch als Chance für die zukünftige Entwicklung nutzen.
Mögliche ÖROK-Arbeitsformate und Maßnahmen:
- Die Realisierbarkeit eines von Bund/Ländern getragenen Stadtregions-Förderprogramms ausgehend von guten Beispielen aus dem Ausland analysieren und allenfalls entwickeln.
- Die bisher noch offenen Punkte der ÖROK-Empfehlung Nr. 55 „Für eine Stadtregionspolitik in Österreich“ unter Berücksichtigung der unterschiedlichen länder- und regionsspezifischen Gegebenheiten bearbeiten.
Raumtypen
größere Stadtregionen, kleinere Stadtregionen mit ihren ländlichen Verdichtungsräumen
Relevante Systeme von Akteur:innen
Bund, Länder, Städte, Gemeinden, Städtebund, Gemeindebund
Instrumente
Raumordnungsgesetze, Raumordnungsprogramme, Bedarfszuweisungen, Förderungen, stadtregionale Strategien und Konzepte