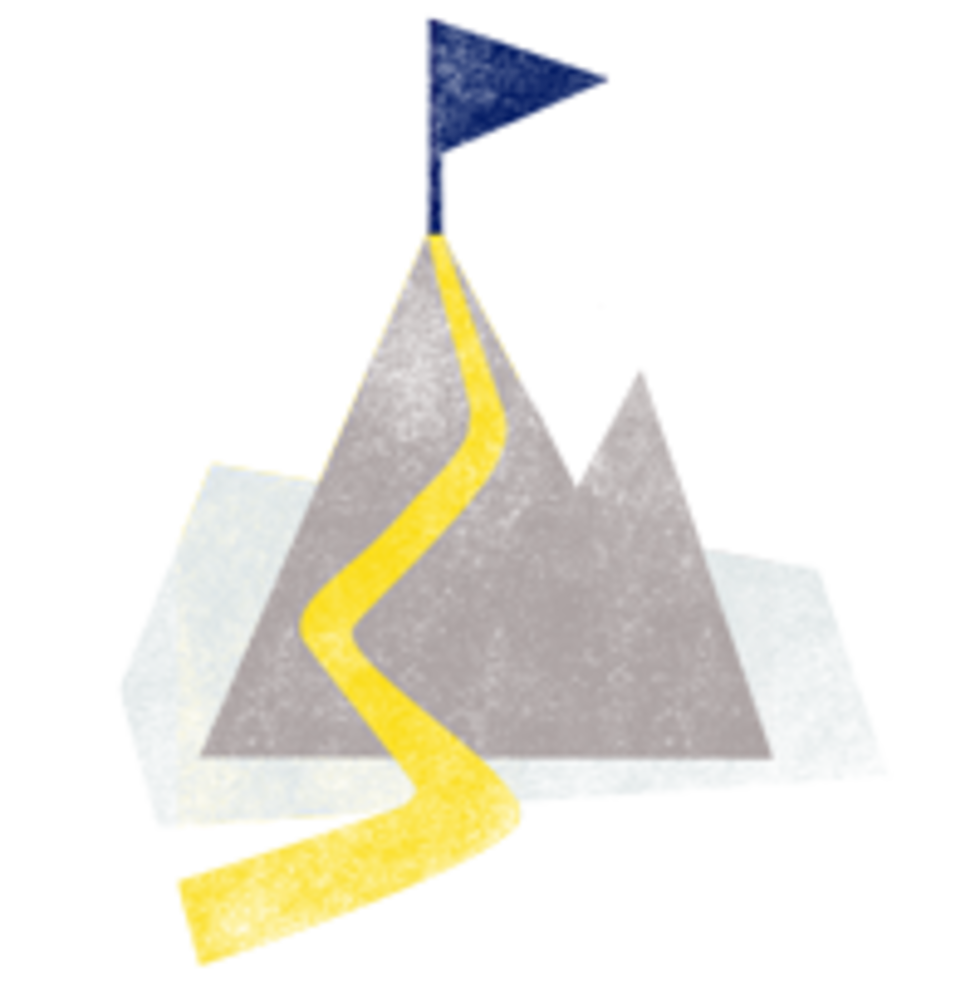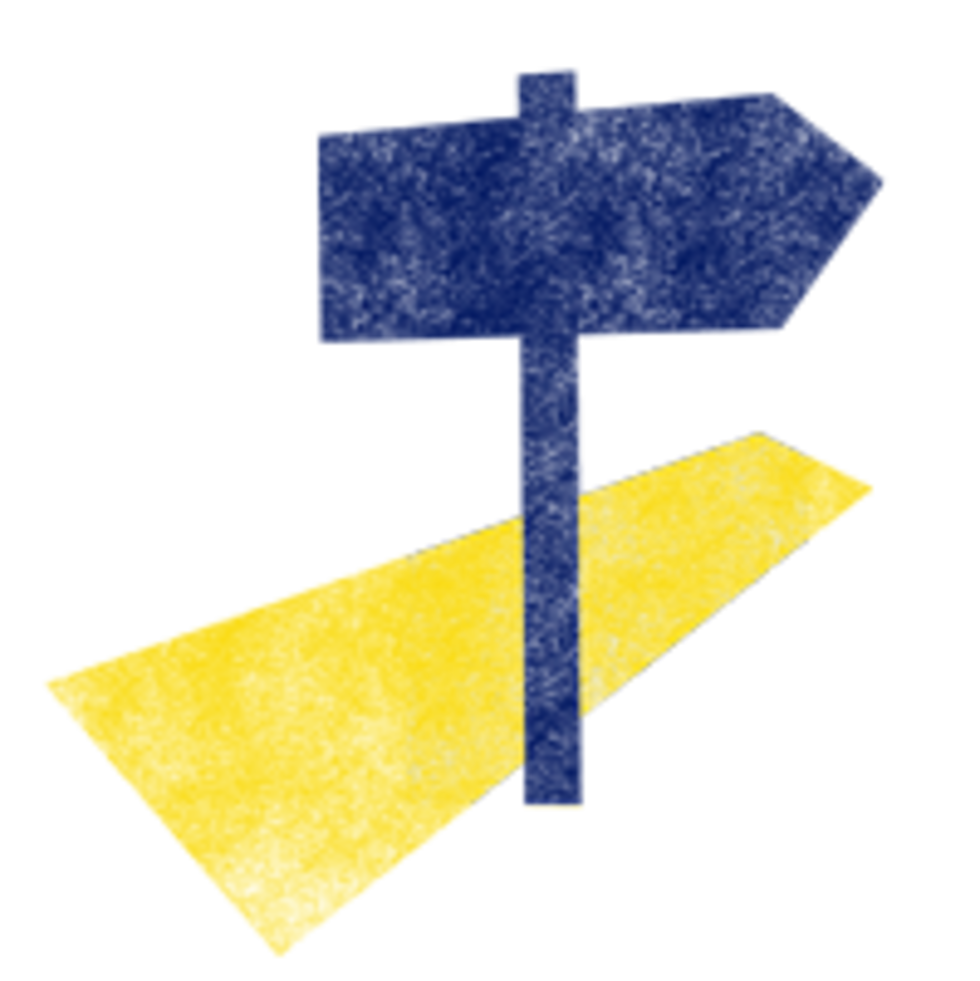
Potenziale für erneuerbare Energie regional erheben und nutzen
Handlungsauftrag 1.1.a
Der Ausbau aller Quellen von erneuerbarer Energie ist zentral für die Erreichung der angestrebten Klimaneutralität. Maßgeblich ist dabei, die konkreten räumlichen Potenziale je nach Raumausstattung differenziert zu erheben. So entsteht ein Gesamtbild für Österreich zur Verteilung der einzelnen Eignungsräume je Energietyp. Diese Eignungsräume können entsprechend gesichert werden. Zum anderen gilt es aber, die Auswirkungen und ökologischen Folgewirkungen in Bezug auf die Flächeninanspruchnahme von neuen Flächen zu prüfen. Bundesweit abgestimmte Eignungs- und Ausschlusskriterien in Bezug auf flächenhafte Nutzungen sind dabei von zentraler Bedeutung. Dasselbe gilt für Richtlinien und Strategien zur Mobilisierung von Potenzialen bereits verbauter oder beanspruchter Flächen. Das betrifft in besonderem Maße auch die Städte und urbanen Räume.
Mögliche ÖROK-Arbeitsformate und Maßnahmen:
- Methoden und Modelle zur Konkretisierung der Potenziale und des Flächenbedarfes für erneuerbare Energie (Erzeugungs- und Übertragungsinfrastruktur) auf regionaler Ebene entwickeln. Dabei eine intelligente Diversifizierung erneuerbarer Energieträger und -technologie berücksichtigen. Bundesweit abgestimmt, werden die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Indikatoren werden im ÖROK-Atlas zum Thema Energie und Umwelt für spezifische Energieformen aufbereitet und im Wärmeatlas zur Verfügung gestellt.
- Eignungs- und Ausschlusskriterien für die Nutzung von Freiflächen für die Energieerzeugung (z.B. für Photovoltaikanlagen) unter Einbeziehung weiterer Freiraumfunktionen konkretisieren und priorisieren. Die Abschätzung der Folgewirkungen auf die Lebensmittelproduktion und die Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen ist dabei zentral.
- Planungsrichtlinien zur vorrangigen Nutzung der Potenziale für erneuerbare Energie auf Gebäuden und technischen Anlagen sowie bereits genutzten Flächen erarbeiten. Strategien zur vorrangigen Mobilisierung dieser Potenziale entwickeln.
Raumtypen
alle ÖREK-Raumtypen mit raumtypenspezifischer Differenzierung betrachten. Für größere und kleinere Stadtregionen und ländliche Verdichtungsräume sowie Achsenräume entlang hochrangiger Verkehrsinfrastruktur den zusätzlichen Fokus auf die Möglichkeiten zur Energiegewinnung auf Gebäuden sowie Abwasser setzen.
Relevante Systeme von Akteur:innen
Bund, Länder, Regionen, Städte, Gemeinden, ÖROK, Fachplaner:innen aus den Bereichen Energie, Raumplanung und Naturschutz sowie geographischer Informationssysteme
Instrumente
ÖREK-Partnerschaft, formelle Instrumente der überörtlichen und örtlichen Raumordnung, Förderanreize, ÖROK-Atlas
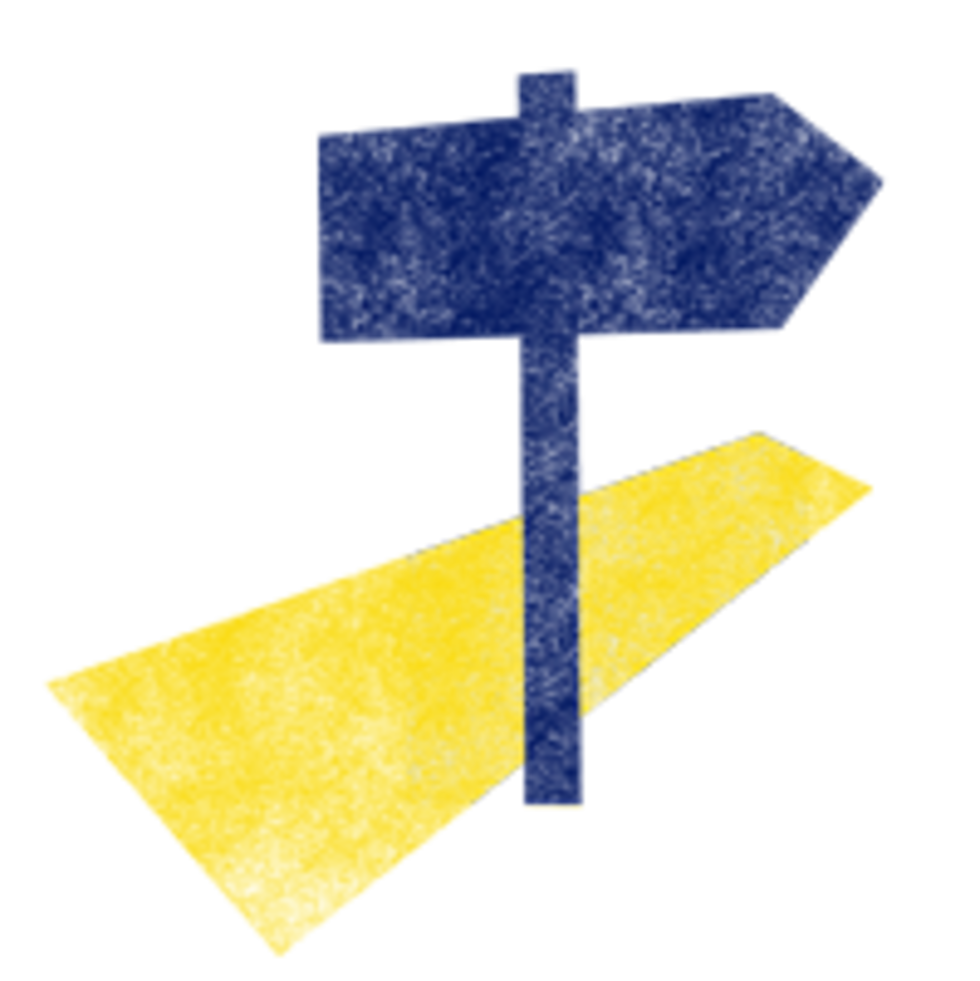
Den Energieverbrauch und -bedarf senken
Handlungsauftrag 1.1b
Im Rahmen der ÖREK-Partnerschaften Energieraumplanung I und II wurde der Beitrag der Raumordnung zur Senkung des Energiebedarfs für Wohnen, Arbeiten und Mobilität bereits intensiv dargelegt. Es wurden fachliche Vorschläge zu Instrumenten und Prozessen konkretisiert. Diese sind unter Maßgabe der länder- und regionsspezifischen Gegebenheiten zielorientiert zu implementieren.
Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen zu können bedarf es umfassender Maßnahmen. Dazu gehören die Entwicklung von kompakten Siedlungsstrukturen und die Auswahl von geeigneten Standorten sowie die deutliche Reduktion des Energiebedarfes und die Einsparung von Energie. Das kann vor allem dann gelingen, wenn das Eingang in alle raum- und energierelevanten Festlegungen in Materiegesetzen findet. Wechselwirkungen und Synergien zwischen Raumnutzung und Bebauung, Energiebedarf und Energieversorgung müssen genutzt und optimiert werden.
Mögliche ÖROK-Arbeitsformate und Maßnahmen:
Bestehende Förderungen sowie gesetzliche Regelungen in Bezug auf raumrelevante Vorgaben und Wirkungen analysieren – „Klima-Check von Gesetzen“. Handlungsbedarf zur Optimierung von Wechselwirkungen und Synergien aufzeigen.
Raumtypen
alle ÖREK-Raumtypen mit raumtypenspezifischer Differenzierung
Relevante Systeme von Akteur:innen
Länder, Regionen, Städte, Gemeinden, Energieversorgung sowie Standortentwicklung und Mobilitätsdienstleistungen
Instrumente
formelle Instrumente der überörtlichen und örtlichen Raumordnung und des
Bauwesens sowie Angebots- und Ausbauplanungen im Bereich Energie und Mobilität
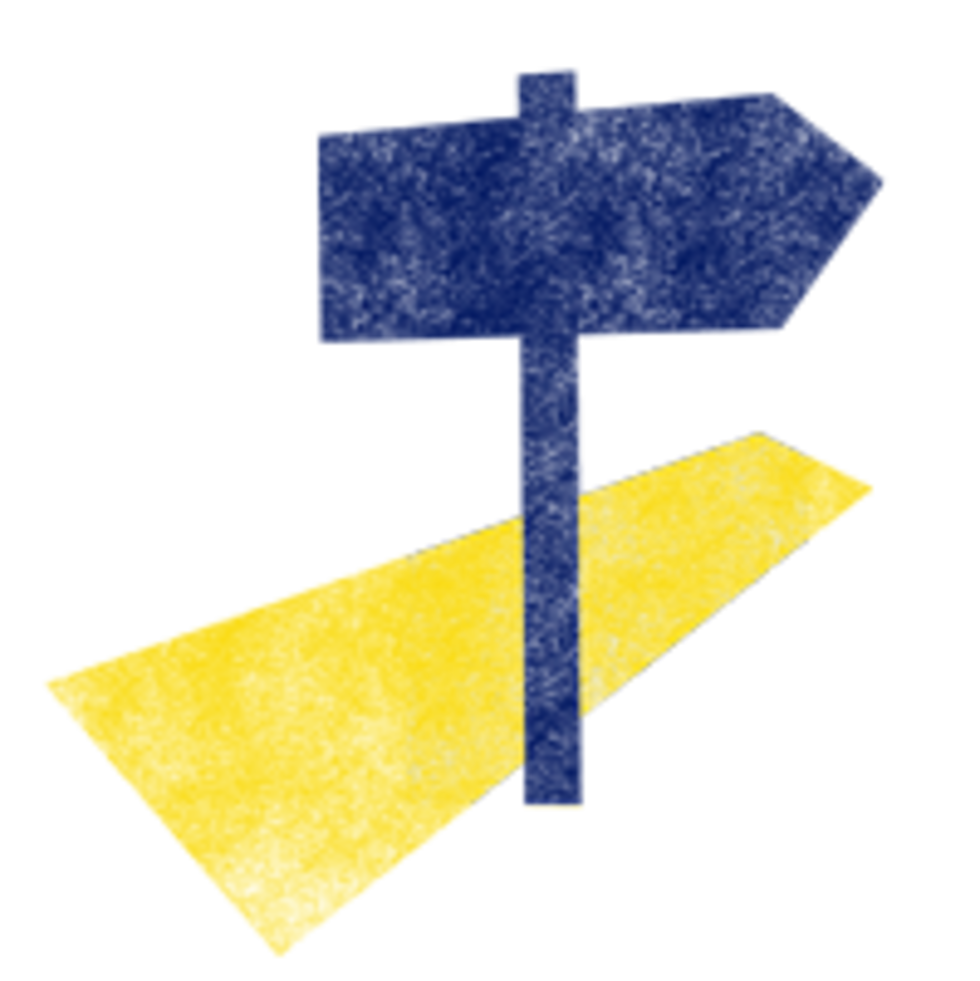
Neue (klein-)regionale Netze ausbauen und überregionale Trassenkorridore sichern
Handlungsauftrag 1.1.c
Neben den Potenzialen zur Energieerzeugung und der Reduktion des Energieverbrauches stellen die Anlagen zur Erzeugung und zur Abnahme der Energie eine weitere maßgebliche Komponente im Zusammenspiel zwischen Energie und Raumplanung dar. Sie reicht von kleinregionalen Netzen und Erzeugungs- bzw. Abnahmemodellen für eine kurze, direkte Verbindung zwischen Erzeugung und Verbrauch bis hin zur Sicherung und koordinierten Planung von überregionalen und transeuropäischen Netzen im Hochspannungsnetz ab 110 kV. Damit soll auch das Ziel zur Sicherung der Stromversorgung durch 100 % Ökostrom (national bilanziell) unterstützt werden.
Mögliche ÖROK-Arbeitsformate und Maßnahmen:
- Ergebnisse der ÖREK-Partnerschaften zur Energieraumplanung um konkrete Kriterien für die formellen Instrumente der überörtlichen und örtlichen Raumordnung ergänzen und adaptieren.
Raumtypen
alle ÖREK-Raumtypen mit raumtypenspezifischer Differenzierung
Relevante Systeme von Akteur:innen
Länder, Regionen, Städte, Gemeinden und Anlageneigentümer:innen sowie Netzbetreiber
Instrumente
Energiekonzepte für Gemeinden und Regionen (vgl. Ergebnisse der ÖREK-Partnerschaft Energieraumplanung), Standortkonzepte, Netzplanungen regionaler Unternehmen für Energieangebot bzw. –versorgung, bürgerschaftlich organisierte Energieversorgungskonzepte